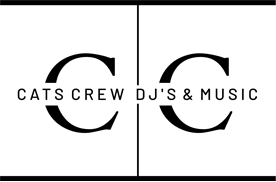DJ / DJANE BERLIN MIETEN
DJane oder DJ – gibt’s da eigentlich einen Unterschied?
Kurz gesagt: DJane ist kein offizieller Begriff.
Denn DJ steht ganz einfach für Disc Jockey – und das ist grammatikalisch schon geschlechtsneutral. Egal ob Frau, Mann oder nonbinär: Wer Platten auflegt (oder heute eher mit USB-Sticks arbeitet ), ist ein DJ.
Ja, wir geben’s zu:
Wir haben schon nächtelang diskutiert, ob wir das korrekt finden – oder ob es doch sogar sehr diskriminierend ist, das Wort DJane zu verwenden. Und ja, es gibt definitiv die besseren
Argumente, den Begriff DJane nicht zu verwenden.
Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann haben wir Ziele:
Wir wollen, dass alle die Chance haben, unsere großartigen weiblichen DJs überhaupt zu finden.
Und vielleicht bist du genau deshalb hier gelandet – weil du in der Suchmaschine nach DJane gesucht hast?
Dann: Herzlich willkommen. Du bist richtig hier.
Würden wir ein Plakat drucken - dann würden wir sicher anders damit umgehen.
Egal, wie du uns nennst – am Ende zählt die
Musik. Und wer sie spürt.
Und dazu sind bei uns ALLE eingeladen. Und das finden wir wichtiger als die Fragestellung.
Frauen an den Decks – Die Geschichte der DJane-Kultur
Die DJ-Kultur gilt als männlich dominiert – und das nicht nur hinter den Plattentellern, sondern auch in ihrer Geschichtsschreibung. Dabei haben Frauen seit den Anfängen der elektronischen Musik und Clubszene entscheidend mitgewirkt. Wer sich auf Spurensuche begibt, findet beeindruckende Persönlichkeiten, die nicht nur Musik gemacht, sondern auch Genres geprägt und Clubräume verändert haben.
Eine der frühesten bekannten weiblichen DJs war Raynelle “DJ” Jones, die bereits 1911 in einer US-Radiostation Musik auflegte – als Frau und Afroamerikanerin ein doppelter Tabubruch. Auch Delia Derbyshire, britische Komponistin und Klangtüftlerin der BBC, war eine Vorreiterin: In den 1960er Jahren experimentierte sie mit synthetischen Sounds und schrieb die elektronische Titelmelodie von Doctor Who – ein Meilenstein, der lange Zeit männlichen Kollegen zugeschrieben wurde.
In der Clubszene machten sich ab den 80er- und 90er-Jahren zunehmend Frauen einen Namen: DJ Rap (UK) brachte Drum’n’Bass in die breite Öffentlichkeit, Miss Kittin (Frankreich) wurde mit Electroclash international bekannt, und DJ Heather (USA) war eine feste Größe im House-Bereich. In Deutschland wurde Marusha mit Rave und Breakbeats zur TV-Ikone, während Ellen Allien und Monika Kruse den Berliner Technosound prägten und internationale Labels gründeten.
Trotz dieser Erfolge blieben Frauen in der DJ-Welt oft unterrepräsentiert – nicht aus Mangel an Talent, sondern wegen struktureller Hürden: Technik wurde als „Männersache“ betrachtet, Auflegepositionen häufig in männlich geprägten Netzwerken vergeben. Viele Künstlerinnen berichten davon, nicht ernst genommen zu werden, ständig ihr Können beweisen zu müssen oder auf Äußerlichkeiten reduziert zu werden.
Doch das Bild wandelt sich. Immer mehr Festivals und Clubs achten heute auf diverse Line-ups, und zahlreiche Plattformen setzen sich dafür ein, weibliche DJs sichtbar zu machen. Medienberichte, Podcasts und Dokumentationen wie “Sisters with Transistors” holen vergessene Pionierinnen zurück ins Rampenlicht. Auch das DJing selbst hat sich verändert: Statt nur Platten zu mischen, geht es heute um Sound-Design, Performance und kuratorisches Gespür.
Das DJ-Pult ist längst nicht mehr nur Technikstation – es ist ein Ort künstlerischer Gestaltung. Wer dort steht, entscheidet, was gehört wird. Und das ist immer auch eine kulturelle Aussage. Die Geschichte der DJane-Kultur ist damit mehr als nur ein Kapitel innerhalb der Musikgeschichte – sie ist ein Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen.
Frauen haben in der elektronischen Musik nicht nur mitgemacht – sie haben mitgeprägt, erfunden, weitergedacht. Und auch wenn noch immer nicht alle gleich laut gehört werden: Die Zukunft der Clubmusik ist weiblicher, diverser und selbstbewusster als je zuvor.